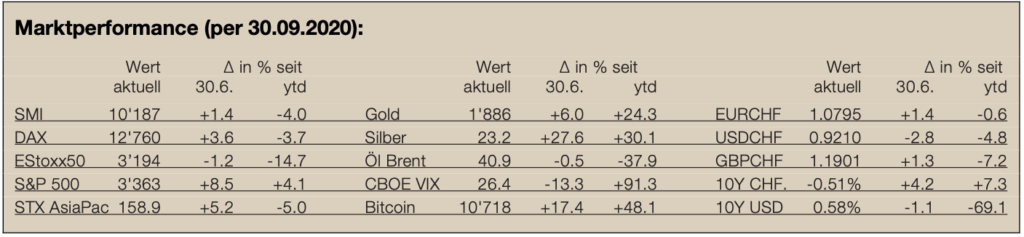
Was sagen uns PMI’s?
Monatlich werden Chefeinkäufer Hunderter Unternehmen befragt, wie sie im Vergleich zum Vormonat u.a. nachfolgende Themen beurteilen: Auftrags- und Lagerbestand, Produktion, Beschäftigung, Preise, generelle Bedingungen. Aus den Antworten wird ein Index berechnet, wobei ein Wert von 50 keine Veränderung, Werte darüber oder darunter eine Verbesserung oder Verschlechterung bedeuten. Diese Einkaufsmanagerindizes (Purchasing Managers Index, PMI) werden für verschiedene Sektoren in rund 30 Ländern erfasst. Sie gelten als Frühindikatoren für die Entwicklung der Wirtschaft.
Im September sind die weltweiten Industrie PMI’s weiter gestiegen und liegen komfortabel über 50 (z.B. globaler Industrie-PMI 52,3, Eurozone 53,7, Schweiz 53,1). Nach dem dramatischen Einbruch der PMI’s im Frühling, zeigt sich also eine V-förmige Erholung. Dies veranlasst die Ökonomen teilweise dazu, ihre Konjunkturprognosen nach oben zu revidieren (bspw. UBS hat BIP-Prognose von -5,1% auf 4,5% angehoben).
Neben diesen positiven Signalen gibt es aber auch einige Gefahren zu beachten. Trotz guter PMI’s sind die Aussagen zum Arbeitsmarkt trübe. Personal wird weiter abgebaut und in der Schweiz befänden sich noch immer 16% der Angestellten in Kurzarbeit. In den USA sank zwar die Arbeitslosenrate von 8,4% auf 7,9%, aber nur, weil neben den rund 660/m neu geschaffenen Stellen im September auch über 700/m Arbeitslose die Arbeitssuche definitiv eingestellt haben. Seit der Krise fehlen in den USA immer noch über 10 Mio. Jobs. Sollten tatsächlich bis nach den Wahlen vom 3. November keine weiteren Hilfsprogramme in den USA beschlossen werden, wird es für viele Personen und Kleinunternehmen ganz schwierig. Weiter steht auch noch ein Brexit-Ultimatum Mitte Oktober im Raum. Oder auch nicht gerade zuversichtlich stimmen die verschärften Massnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von Covid-19 in den Grossstädten wie Madrid, Paris und London. Steigende Ansteckungszahlen könnten einen erneuten Lockdown mit sich bringen.
Zusammengefasst bleibt die Unsicherheit an den Aktienmärkten gross und damit ist auch mit volatilen Börsen zu rechnen. Wie die starken Schwankungen in diesem Jahr gezeigt haben, lohnt es sich aber investiert zu bleiben, weil man sonst nach einem Marktrücksetzer Gefahr läuft, den Aufstieg zu verpassen. Überprüfen Sie Ihr Portfolio auf die Branchenpositionierung, auf Unternehmen mit soliden Bilanzen und Zukunftsaussichten. Gerne unterstützen wir Sie dabei oder stehen Ihnen für eine Zweitmeinung zur Verfügung.
Immobilienbesitz (von Ehepaaren) – Miteigentum, Gesamteigentum oder gar Alleineigentum?
Über die Form des Eigentums der eigenen Liegenschaft machen sich Ehegatten beim Kauf häufig zu wenig Gedanken. Die Grundbuchämter verwenden oft Standardverträge, in welchen meistens das hälftige Miteigentum vorgesehen ist. Bei der späteren Zuteilung der Liegenschaft oder des Liegenschaftsgewinns bei einer allfälligen Trennung, Scheidung oder eines Todesfalls kann jedoch die Form des Eigentums erhebliche Auswirkungen haben. Es ist sinnvoll, sich bei einem Kauf oder bei nachträglichen Investitionen über Optionen beraten zu lassen. Einige Unterschiede oder mögliche Stolpersteine werden nachfolgend kurz beschrieben, ersetzen jedoch keine umfassende Beratung.
Alleineigentum:
Beim Alleineigentum gehört die Liegenschaft, wie es der Name schon sagt, einem Ehegatten alleine. Er kann also auch alleine darüber verfügen. Dient die Liegenschaft jedoch als Familienwohnung, gibt es betreffend Verfügungsgewalt Einschränkungen, weshalb diese Form bei Familienwohnungen seltener gewählt wird. So benötigt der Alleineigentümer die ausdrückliche Zustimmung des Ehegatten, wenn er die Liegenschaft veräussern oder durch ein anderes Rechtsgeschäft die Familienwohnung beschränken möchte (ZGB 169 I). Im Scheidungsfall bleibt dafür die Liegenschaft im Eigentum des Alleineigentümers und wird nicht dem anderen Ehegatten zugeteilt. Das Gericht kann allenfalls für die Liegenschaft des Alleineigentümers dem anderen Ehegatten gegen eine Entschädigung für eine beschränkte Zeit ein Wohnrecht gewähren. Stehen die Ehegatten im Güterstand der Gütertrennung, so ist eine Mehrwertbeteiligung (analog ZGB 206 bei Errungenschaftsbeteiligung) ausgeschlossen. Dies gilt es zu beachten, wenn ein Ehepartner in die Liegenschaft des anderen Ehepartners investiert. Bei Errungenschaftsbeteiligung wird der Mehrwert der Hypothek grundsätzlich derjenigen Gütermasse zugeschlagen, in welcher die Liegenschaft im Alleineigentum steht. Dies kann ebenfalls zu unbefriedigenden Ergebnissen führen.
Miteigentum:
Vereinfacht gesagt, bedeutet Miteigentum, dass die Sache den Miteigentümern nur zu einem Bruchteil zusteht (z.B. ½). Grundsätzlich kann jeder Miteigentümer über seinen Bruchteil selbständig verfügen. Für Ehegatten im Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung gilt allerdings die Einschränkung, dass kein Ehegatte ohne Zustimmung des anderen Ehegatten über seinen Miteigentumsanteil verfügen kann, sofern nichts anderes vereinbart ist (ZGB 201 II). Beim Verkauf steht dem anderen Miteigentümer ein Vorkaufsrecht zu. Mit Miteigentum trägt jeder die Kosten nach seiner Quote und auch allfällige Wertsteigerungen werden nach diesen Quoten verteilt. Daher macht es Sinn, dass Investitionen und Kosten für den Unterhalt von den Miteigentümern gemäss Ihren Quoten getragen werden. Aufgrund der Nennwertgarantie (ZGB 206 I) trägt die finanziell schwächere Partei im Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung ein überproportionales Risiko, wenn sich der Wert der Liegenschaft über die Jahre verringert.
Gesamteigentum:
Beim Gesamteigentum wird zwingend ein sogenanntes Gesamthandverhältnis vorausgesetzt, z.B. eine einfache Gesellschaft oder der Güterstand der Gütergemeinschaft. Damit können die Eigentümer immer nur gemeinsam Verfügungen über die Liegenschaft treffen und z.B. für Hypothekarschulden haften die Gesamteigentümer solidarisch. Ohne Vereinbarung zwischen den Ehegatten gilt bei Gesamteigentum, dass ein allfälliger Gewinn beim Verkauf der Liegenschaft hälftig geteilt wird, und zwar unabhängig von den geleisteten Beiträgen. Dies kann zu unbefriedigenden Ergebnissen führen. Allerdings können die Gesamteigentümer über den internen Gesellschaftsvertrag frei beschliessen, wer welchen Beitrag an die Gesellschaft zu leisten hat und wie ein Gewinn geteilt werden soll. Solche Vereinbarungen sind zwar formlos möglich, aus Beweisgründen empfiehlt sich aber Schriftlichkeit.
Für den Entscheid, welche Eigentumsform für Sie die geeignete ist, müssen die finanzielle Situation (Einkommen, Vermögen, Eigenmitteleinsatz, WEF-Vorbezüge, Hypotheken), die güterrechtlichen Verhältnisse und auch nicht monetäre Aspekte (Bezug zur Liegenschaft, Kinder, geschäftliche Nutzung, etc.) beachtet werden. Zusätzlich zur Eigentumsform lohnt es sich, auch ehe- und erbvertragliche, respektive testamentarische Regelungen zu treffen. Bei Streitigkeiten steht aber oft nicht die rechtliche Lage, sondern der Wert der Liegenschaft im Zentrum. Eine Vereinbarung über akzeptierte Verkehrswerte oder die Einigung über einen gemeinsamen Schätzer kann hier langwierige und kostspielige Verfahren verhindern.
